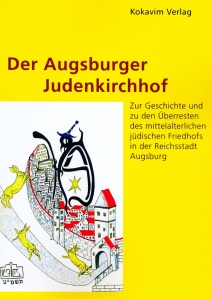December 11, 2023
am 10. Dezember:
1871 Geburtstag von Julius Bach (gest. 1929);
am 11. Dezember:
1736 Tod von Moses Chaim Israel aus Steppach, Alter 38;
am 12. Dezember:
1264 Abraham von Augsburg beim Augsburger Rathaus verbrannt. Er war ein zum Judentum konvertierter Christ, der zuvor Oberhaupt der „Schuhlosen“, des Barfüßer Ordens in Augsburg war, wurde aber zunehmend feindselig gegenüber seiner früheren christlichen Religion, ging in Kirchen und zerschlug die Köpfe der früher von ihm selbst angebeteten „Götzenbilder“. In Sinzig bei Bonn sollen deshalb wegen ihm rund 60 Juden erschlagen worden sein. Er selbst wurde in Augsburg hingerichtet, wobei verschiedene Überlieferungen leicht abweichende Details und Daten nennen.
am 13. Dezember:
1919 Tod von Philip Pinchas Zahn im Alter von 18 Jahren;
am 14. Dezember:
2016 Tod von Chana Tausendfels, Malerin und Autorin, im Alter von 53 Jahren;

Chana Tausendfels 2000
am 15. Dezember:
1918 Tod von Hugo Bein im Münchner Militärkrankenhaus, wo er seinen Verwundungen, die er sich im Fronteinsatz in Belgien kurz vor Kriegsende zugezogen hatte, erlegen ist, geb. 1881;
am 16. Dezember:
1779 Tod von Efraim Ulmo aus Pfersee, im Alter von 75 Jahren;
- Dezember:
1854 Geburtstag von Irene Binswanger, geb. Guggenheimer (gest. 1931);
3000 weitere Daten:
YORZAIT
Gedenk-Kalender zur Geschichte der Juden in Augsburg,
mit Fotos und Kurzbiografien
ISBN: 978 3755 733 690
Ringbuch, 220 Seiten, DIN A4

order NOW
 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, Augsburg Cemetery Hochfeld, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JHVA, Yorzait | Tagged: Abraham of Augsburg, Abraham von Augsburg, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bayern, Chana Tausendfels, Аугсбург, Germany, Jewish, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JHVA, Kriegshaber, Medinat Schwaben, Pfersee, Rabbiner, Ulmo, Yehuda Shenef, אוגסבורג, בית כנסת, בית קברות |
Augsburg, Augsburg Cemetery Hochfeld, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JHVA, Yorzait | Tagged: Abraham of Augsburg, Abraham von Augsburg, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bayern, Chana Tausendfels, Аугсбург, Germany, Jewish, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JHVA, Kriegshaber, Medinat Schwaben, Pfersee, Rabbiner, Ulmo, Yehuda Shenef, אוגסבורג, בית כנסת, בית קברות |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
August 24, 2023
Heute vor 725 Jahren, am 24. August 1298 wurde in Augsburg eine Urkunde der jüdischen Gemeinde zu Augsburg in mittelhochdeutscher Sprache mit Gemeindesiegel datiert. Darin verpflichten 13 Führer der Gemeinde (unter ihnen zwei Frauen) die jüdische Gemeinde einen vorgebebenen Abschnitt der Augsburger Stadtmauer in der Länge einiger hundert Meter auf eigene Kosten zu bauen, als Dank gegenüber Kaiser und Stadt für den Schutz vor den sog. “Rintfleisch” – Ausschreitungen. In späteren Stadtkarten heißt der Abschnitt der Stadtmauer “Judenwall”.
Die Urkunde überliefert das selbstbewusste hebräisch-lateinische Siegel der jüdischen Gemeinde zu Augsburg mit dem Habsburger Doppeladler und dem Judenhut anstelle der Kaiserkrone.

(Jewish Encyclopedia, 1910)
חותם הקהילה היהודית באוגסבורג
שנת נ’ח לפק
Zur Geschichte siehe:
Yehuda Shenef
“Wann immer ich von Deiner Ehre erzähle …”
Der Augsburger Judenkirchhof – zu Geschichte und Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der Reichsstadt Augsburg
(Jüdische Friedhöfe in Augsburg, Band 1)
ISBN : 978-3-7519-7187-4

 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JUDAISM יהדות | Tagged: 1298, 24. August, 725 Jahre, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Аугсбург, jüdisches Siegel, Jewish, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, Jewish seal 1298, Judenwall, signet, Stadtmauer Augsburg, אוגסבורג, חותם הקהילה היהודית באוגסבורג |
Augsburg, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JUDAISM יהדות | Tagged: 1298, 24. August, 725 Jahre, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Аугсбург, jüdisches Siegel, Jewish, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, Jewish seal 1298, Judenwall, signet, Stadtmauer Augsburg, אוגסבורג, חותם הקהילה היהודית באוגסבורג |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
July 20, 2023
Das neue Buch ist druckfrisch, nächste Woche im Handel, bzw. bestellbar:
“Unterwegs im jüdischen Augsburg
– 700 Plätze jüdischer Ortsgeschichte im Stadtgebiet”
ISBN: 978 3757 830 625

 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Pfersee, Steppach | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, Germany, Geschichte, Jüdischer Friedhof, Jüdisches Augsburg, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JHVA, Judenkirchhof, Kriegshaber, Pfersee, Synagoge, Ulmo, Yehuda Shenef, אוגסבורג |
Augsburg, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Pfersee, Steppach | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, Germany, Geschichte, Jüdischer Friedhof, Jüdisches Augsburg, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, JHVA, Judenkirchhof, Kriegshaber, Pfersee, Synagoge, Ulmo, Yehuda Shenef, אוגסבורג |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
May 10, 2023
Yehuda David Shenef
YORZAIT
Gedenk-Kalender zur Geschichte der Juden in Augsburg,
mit Fotos und Kurzbiografien

ISBN: 978 3755 733 690
Ringbuch, 220 Seiten, DIN A4
Erscheinungsdatum: 09.05.2023 (- 33 ba’Omer)
 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Pfersee, Steppach | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, Friedhof, Gedenk-Kalender, Gedenktage, Geschichte, History, jüdisch, JHVA, Juden, Judenkirchhof, Kriegshaber, Pfersee, Schwaben, Ulmo, Yehuda David Shenef, Yehuda Shenef, Yorzait, אוגסבורג, בית קברות |
Augsburg, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Pfersee, Steppach | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, Friedhof, Gedenk-Kalender, Gedenktage, Geschichte, History, jüdisch, JHVA, Juden, Judenkirchhof, Kriegshaber, Pfersee, Schwaben, Ulmo, Yehuda David Shenef, Yehuda Shenef, Yorzait, אוגסבורג, בית קברות |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
November 11, 2022
Im Festsaal der Synagoge Augsburg, Halderstraße
Sonntag, 13. November 2022, 15 Uhr 30
Yehuda Shenef, “Die jüdischen Friedhöfe in Augsburg”
zum Auftakt der “2. jüdischen Kulturwoche Schwaben” (Programm: https://dig-augsburg.de/wp-content/uploads/2022/11/Kulturwoche-Online-Programm-9-1.pdf )


 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, Augsburg Cemetery Hochfeld, Augsburg Hochfeld, Bavaria Bayern, Deutschland, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Kriegshaber Pfersee Cemetery, LITERATURE, Medinat Schwaben, Pfersee, Schlipsheim, Schwaben, TERMINE appointments | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, jüdisch, Jüdischer Friedhof, Jewish history, JHVA, Kriegshaber, Medinat Schwaben, Mittelalter, mittelalterliches Augsburg, Pfersee, Schwaben, Synagoge, Synagogue, Ulmo, Yehuda Shenef, אוגסבורג, בית קברות |
Augsburg, Augsburg Cemetery Hochfeld, Augsburg Hochfeld, Bavaria Bayern, Deutschland, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Kriegshaber Pfersee Cemetery, LITERATURE, Medinat Schwaben, Pfersee, Schlipsheim, Schwaben, TERMINE appointments | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, jüdisch, Jüdischer Friedhof, Jewish history, JHVA, Kriegshaber, Medinat Schwaben, Mittelalter, mittelalterliches Augsburg, Pfersee, Schwaben, Synagoge, Synagogue, Ulmo, Yehuda Shenef, אוגסבורג, בית קברות |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
December 13, 2020
Wann immer ich von Deiner Ehre erzähle …
Der Augsburger Judenkirchhof – zu Geschichte und Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der Reichsstadt Augsburg
Band 1: Jüdische Friedhöfe in Augsburg
Yehuda Shenef

ISBN: 9783751971874
Hardcover, 224 Seiten, DIN A 4
Erscheinungsdatum: 12.12.2020
Die mittelalterliche jüdische Gemeinde in Augsburg zählte über Generationen zu den bedeutendsten in Europa.
Die Augsburger Juden besaßen eine herausragende Rechtsstellung im Römischen Reich, die als Vorbild für viele andere Städte und Gemeinden diente, wie etwa für die Juden von München. Kaiser Ludwig der Bayer verpfändete gar seine Stadt München an die Richter der jüdischen Gemeinde, um Kredite aus Augsburg zu erhalten.
In den Augsburger Schulen lehrten weit überregional bekannte Rabbiner, die Vorbilder und Sprecher ihrer Generationen waren. Auf sie gehen eine Vielzahl bedeutender Schriftwerke zurück, die wie etwa die Bestimmungen zur Schechita von Rabbi Jakob Weil (MaHaRiW), dem letzten mittelalterlichen Rabbiner in Augsburg, noch heute weltweite Geltung besitzen. Überlieferungen und Handschriften zeugen davon, dass Augsburger Juden auch militärtechnisch Vorreiter ihrer Zeit und prägend waren.
Vom mittelalterlichen Friedhof, dem Judenkirchhof, gibt es trotz Größe und Bedeutung der Gemeinde der Augsburger Juden nur wenige Aufzeichnungen und noch spärlichere Überreste. Dennoch sind einige Grabsteine, Fragmente und Inschriften aus der Zeit zwischen 1230 und 1445 überliefert und teilweise auch noch erhalten, eingemauert in Innenhöfen, ausgestellt in Museen oder gelagert in Kellern. Fünf davon wurden erst in den letzten Jahrzehnten entdeckt. Weitere Funde sind überall in der Altstadt möglich.
Das Buch zeichnet anhand von mittelhochdeutschen, lateinischen, hebräischen und jüdisch-taitschen Schriftquellen die Geschichte des in der Öffentlichkeit kaum bekannten, auch von Fachleuten weitgehend ignorierten Friedhofs und den damit verbundenen Abschnitten der Stadtgeschichte nach und trägt erstmals alle ermittelbaren Daten und Erkenntnisse zusammen.
Neben Fotos und Plänen von Schauplätzen werden auch alle bekannten Inschriften präsentiert, übersetzt und kommentiert. Dazu gibt es ein Register aller namentlich ermittelbaren Juden des mittelalterlichen Augsburgs.
Die stark erweiterte Neuauflage des Buches von 2013 bietet darüber hinaus auch eine viele Portraits von mittelalterlichen Augsburger Juden und ihrer Werke, Dazu zählt auch der aus Prag stammende Drucker Chaim Schwarz, der im Laufe von Jahren eine Anzahl bedeutsamer Bücher in hebräischer Sprache und Schrift in Augsburg druckte, wie die weit überregional einflussreiche Augsburger Pessach-Haggada.
Das Buch ist chronologisch der erste von drei Bänden zu den drei jüdischen Friedhöfen der Juden in Augsburg.
 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, Austria, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, LITERATURE, Medinat Schwaben | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Augsburger Judenkirchhof, Bayerisch-Schwaben, Cemetery, Аугсбург, Friedhof, Germany, Geschichte, History, jüdisch, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, JHVA, Juden, Judenkirchhof, Medinat Schwaben, mittelalterliches Augsburg, Rabbiner, Talmud, Yehuda Shenef, בית כנסת, בית קברות |
Augsburg, Austria, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JHVA, JUDAISM יהדות, LITERATURE, Medinat Schwaben | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Augsburger Judenkirchhof, Bayerisch-Schwaben, Cemetery, Аугсбург, Friedhof, Germany, Geschichte, History, jüdisch, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, JHVA, Juden, Judenkirchhof, Medinat Schwaben, mittelalterliches Augsburg, Rabbiner, Talmud, Yehuda Shenef, בית כנסת, בית קברות |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
August 7, 2013
Es ist soweit, das neue Buch ist fertig und ist ab 15. August bereits druckfrisch zu haben:
Das Haus der drei Sterne
Die Geschichte des jüdischen Friedhofs von Pfersee, Kriegshaber und Steppach bei Augsburg, in Österreich, Bayern und Deutschland

ISBN: 978-944092-02-7
184 Seiten
von Yehuda Shenef, 1. Auflage, August 2013
Erläutert die Umstände, wie es nach der Ausweisung der Juden aus Augsburg nach 1440 zur Gründung jüdischer Gemeinden gleich nebenan in Oberhausen, Pfersee, Kriegshaber und Steppach kam, unter welchen mysteriösen Umständen der Friedhof begründet wurde, warum die Errichtung des Wärterhauses beinahe zum offenen Krieg führte, wie sich tatsächliche Kriege auf die Gemeinden auswirkten und wie das historische Umfeld beschaffen war.
Es schildert den obskuren Besuch eines Spendensammlers kabbalistischer jüdischer Gemeinden aus dem Lande Israel und an Hand einer konkreten Linie die ununterbrochene direkte Abstammung Pferseer und Kriegshaber Juden von mittelalterlichen Augsburger Juden, schließlich wird auch dargelegt, dass auch das Märchen von der jüdischen Weltverschwörung seinen (literarischen Ursprung) womöglich in Kriegshaber hatte.
Dazu gibt es Photos, Karten, viele überraschende, niemals zuvor veröffentliche Details aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, um die bald vierhundertjährige Geschichte des Friedhofs, der kurz davor steht, wieder für weitere Begräbnisse genutzt zu werden, verständlich zu machen.
Erhältlich bei SOL-Service, Schrobenhausen
bei Amazon, Weltbild und Co.
im Buchhandel
 4 Comments |
4 Comments |  Augsburg, Bavaria Bayern, GENEALOGY, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Kriegshaber Pfersee Cemetery, Medinat Schwaben, Pfersee, Steppach | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Bayern, Cemetery, Das Haus der drei Sterne, Аугсбург, Germany, Geschichte, History, Jüdischer Friedhof, Jewish, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, Kriegshaber, Medinat Schwaben, Obermayer, Pfersee, Rabbiner, Schwaben, Ulmo, אוגסבורג, בית קברות |
Augsburg, Bavaria Bayern, GENEALOGY, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, JUDAISM יהדות, Kriegshaber, Kriegshaber Pfersee Cemetery, Medinat Schwaben, Pfersee, Steppach | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Bayern, Cemetery, Das Haus der drei Sterne, Аугсбург, Germany, Geschichte, History, Jüdischer Friedhof, Jewish, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, Kriegshaber, Medinat Schwaben, Obermayer, Pfersee, Rabbiner, Schwaben, Ulmo, אוגסבורג, בית קברות |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
April 25, 2013

Am Elias Holl Platz, mnachen besser bekannt als “Platz-an-der-Rückseite-vom-Rathaus” sind derzeit Ausgrabungen zu sehen. Bei ebensolchen im Jahre 1928 wurden an dieser Stelle einige Fragmente mittelalterlicher hebräischer Grabsteine gefunden, die im Buch zum mittelalterlichen Judenkirchhof beschrieben sind:

At Elias Holl Platz which is at the “backsite of the 400 years monumental Augsburg townhall there are some diggings. When in 1928 the last time there were some a number of fragments of medieval Hebrew grave markers from the Jewish Cemetery (Judenkirchhof) were discovered right there. It may be assumed that still there is the reported number of “several hundred” so to say “in situ” …
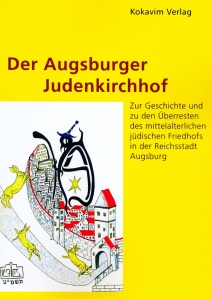
Kokavim-Verlag, 2013, 176 Seiten
ISBN: 978-3-944092-01-0
Preis: 29.50 €
Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenkirchhof – Zur Geschichte und zu den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der Reichsstadt Augsburg
 Leave a Comment » |
Leave a Comment » |  Augsburg, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, Medinat Schwaben | Tagged: Archäologie, archeology, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Augsburger Judenkirchhof, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Bayern, Cemetery, Аугсбург, elias holl, Elias Holl Platz, excavations, Friedhof, Germany, Geschichte, History, Jüdischer Friedhof, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Judenkirchhof, Medinat Schwaben, Mittelalter, mittelalterliches Augsburg, Rathaus, אוגסבורג, בית קברות |
Augsburg, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish Germany, Medinat Schwaben | Tagged: Archäologie, archeology, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Augsburger Judenkirchhof, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Bayern, Cemetery, Аугсбург, elias holl, Elias Holl Platz, excavations, Friedhof, Germany, Geschichte, History, Jüdischer Friedhof, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Judenkirchhof, Medinat Schwaben, Mittelalter, mittelalterliches Augsburg, Rathaus, אוגסבורג, בית קברות |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
January 18, 2013
Ab sofort erhältlich bei info@sol-service.de
Tel: 08252/ 88 14 80 / Fax: 08252 / 88 14 829
und im Buchhandel
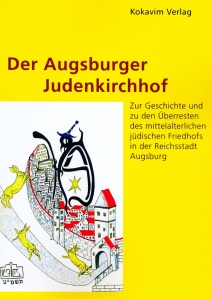
Kokavim-Verlag, 2013, 176 Seiten
ISBN: 978-3-944092-01-0
Preis: 29.50 €
Band 1 der Buchserie zur Geschichte der jüdischen Friedhöfe in Augsburg und Schwaben:
Yehuda Shenef: Der Augsburger Judenkirchhof – Zur Geschichte und zu den Überresten des mittelalterlichen jüdischen Friedhofs in der Reichsstadt Augsburg
Zum Inhalt: Die mittelalterliche jüdische Gemeinde in Augsburg war in ihrer Zeit eine der bedeutendsten in Europa. Aus eigenen Mitteln baute sie einen Teil der Stadtmauer. Die Augsburger Juden besaßen eine herausragende Rechtsstellung, die Vorbild für viele andere Städte und Gemeinden war. In ihren Schulen lehrten wohlbekannte und einflussreiche Gelehrte. Kaiser Ludwig verpfändete seine Stadt München an jüdische Kaufleute in Augsburg und nicht zuletzt wurden eine Reihe der frühesten hebräischen Drucke in Augsburg gefertigt.
Vom mittelalterlichen Friedhof, dem „Judenkirchhof“ gibt es trotz der Größe und Bedeutung der Gemeinde nur wenige Aufzeichnungen und Überreste. Dennoch sind einige Grabsteine und Inschriften aus der Zeit von 1230 bis 1445 überliefert und teilweise erhalten. Fünf davon wurden erst in den letzten Jahren entdeckt.
Das Buch zeichnet anhand von mittelhochdeutschen, lateinischen, hebräischen und jüdisch-taitschen Schriftquellen die Geschichte des in der Öffentlichkeit kaum bekannten Friedhofs und den damit verbundenen Abschnitt der Stadtgeschichte nach und trägt erstmals alle bislang bekannten Daten und Erkenntnisse zusammen. Neben zahlreichen, meist farbigen Fotos und Plänen werden alle bekannten Inschriften präsentiert, übersetzt und kommentiert. Ein Verzeichnis aller bekannt gewordenen Juden des mittelalterlichen Augsburg und Stammbäume von Familien, deren Nachkommen später wieder in der Umgebung Augsburgs siedelten, runden den ersten Band ab, woran der zweite, der sich mit dem Friedhof der Gemeinden Pfersee, Kriegshaber und Steppach befasst, anschließt.
Zu den bekannten Herkunftsorten der mittelalterlichen Augsburger Juden gehören: Aichach, Friedberg, Ingolstadt, Schrobenhausen, Basel, Zürich, Trier, Köln, Wien, Worms, Speyer, Mainz, Ulm, Rothenburg ob der Tauber, Sonthofen, Esslingen, Schaffhausen, Koblenz, Nürnberg, Dinkelsbühl, Oettingen, Stuttgart, Nördlingen, Harburg, Pappenheim, Regensburg, Neuburg, Höchstädt, Dillingen, Lauingen/Donau, Frankfurt am Main, Landau, Wertingen, Landsberg am Lech, Zusmarshausen, Mühldorf am Inn, Mindelheim, Memmingen, München, Donauwörth (Werth), Freising, Bischoffsheim, Strassburg, Günzburg, Heidelberg und Burgau.
* * *
Anmerkung zur Seite 9: Xanten ist nicht in der Schweiz, gemeint war natürlich die Sonsbecker Schweiz.
* * *
Band 2 zur Geschichte des jüdischen Friedhofs in Kriegshaber / Pfersee erscheint im Frühjahr 2013
Band 3 zur Geschichte des jüdischen Friedhofs Hochfeld (Haunstetter Straße/ Alter Postweg) erscheint im Frühsommer 2013
Band 4 zur Geschichte des jüdischen Friedhofs Binswangen erscheint im Sommer 2013
http://kokavim.wordpress.com/
 2 Comments |
2 Comments |  Augsburg, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, LITERATURE, Medinat Schwaben | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Augsburger Judenkirchhof, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Bayern, Book, Buch, Аугсбург, GENEALOGY, German Jewish History, Geschichte, Hebräische Grabsteine, Hebrew grave marker, Jakob Weil, jüdische geschichte, Jüdischer Friedhof, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, Judenkirchhof, Kalonimos, Kokavim-Verlag, medieval cemetery, Medinat Schwaben, mittelalterlicher Friedhof, Neuerscheinung, Yehuda Shenef, אבן קבר, אוגסבורג, בית קברות, בית קברים, ההיסטוריה של ימי הביניים, ימי ביניים, מצבות, עברית, קהילה יהודיה |
Augsburg, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, LITERATURE, Medinat Schwaben | Tagged: Augsburg, Augsburg im Mittelalter, Augsburger Judenkirchhof, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Bayern, Book, Buch, Аугсбург, GENEALOGY, German Jewish History, Geschichte, Hebräische Grabsteine, Hebrew grave marker, Jakob Weil, jüdische geschichte, Jüdischer Friedhof, Jewish Cemetery, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, Jewish history, Judenkirchhof, Kalonimos, Kokavim-Verlag, medieval cemetery, Medinat Schwaben, mittelalterlicher Friedhof, Neuerscheinung, Yehuda Shenef, אבן קבר, אוגסבורג, בית קברות, בית קברים, ההיסטוריה של ימי הביניים, ימי ביניים, מצבות, עברית, קהילה יהודיה |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda
January 10, 2013
In Adelsried sind die Dinge recht kompakt, da ist das Rathaus, der Friseur, der Briefkasten, die Kunst …


die Kirche, die Ampel, die Bäume, der Kran
Das mittelalterliche Augsburger Achtbuch, das so hieß, weil dort geächtete (nicht: geachtete!) Personen verzeichnet wurden. “Alle Achtung” war demnach wenig erstrebenswert, da man je nach Delikt, Einschätzung oder Richter für ein paar Jahre und Meilen oder auf ewig aus der Stadt gebannt war und man sich nicht nähern durfte als drei oder sechs Meilen. Wurde man doch erwischt, konnten recht drastische Körperstrafen verhängt werden, beispielsweise Hände abhacken oder das Herausreißen der Zunge … oder die Blendung der Augen …

Der “goldene Engel von Adesried” gedenkt “Den gefallenen Helden der Gemeinde Adelsried in Deutschlands schwerster Zeit 1914 – 1918“

Im Jahr 1372 verzeichnet das reichstädtische Achtbuch die beiden Juden Mathys (Matthias) und Mosse (Moses) aus Adelsried. Da sie (offenbar betrunken) in der Judengasse Schlägereien anzettelten und Unruhe stifteten, wurden sie seitens der Stadt Augsburg gebannt. Sollten sie gegen den Bann verstoßen, drohte man ihnen die Hände abzuhaken. Weiteres ist nicht bekannt, auch nicht über “die Juden von Adelsried”, die es offenbar zeitweilig auch gab. Adelsried war damals eine Besitzung des Augustinischen Heilig Kreutz Klosters in Augsburg, das sich nahe des jüdischen Viertels der Altstadt befand.
Heute hat der ca. 15 km nordwestliche von Augsburg gelegene Ort (mit Eingemeindungen: Kruichen und Engelshof) etwa zweitausend Einwohner und ist dem Rest der Welt vor allem für seinen Zugang zur Autobahn A8 (München – Stuttgart Anschlussstelle 71a) bekannt, künftig vielleicht auch für seine “jüdische Geschichtsepisode” (auch wenn es wohl nur eine einzige ist). 😉

אדעלסריעד ראַטהאָיספּלאַטז
In 1372 the criminal book of medieval Augsburg registered two young Jewish men (probably brothers) Mosse (Moshe) and Mathys (Matthew) of Adeslried, a small village about ten miles from the Imperial City in possession of an Augsburg cloister. Both men got on rampage at the Judengasse (the main street of the Jewish quarter) and brew some drunken brawl. The magistrate of Augsburg banished both Jewish boozers for life. The breach of this commandment was threatened by the cutoff of their hands.
 1 Comment |
1 Comment |  Adelsried, Augsburg, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte | Tagged: 1372, Achtbuch, Adelsried, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, augsburger, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, jewish men, Medinat Schwaben, Mittelalter, moshe, rest der welt, אַדעלסריעד, אדעלסריעד, אוגסבורג |
Adelsried, Augsburg, Bavaria Bayern, Germany, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte | Tagged: 1372, Achtbuch, Adelsried, Augsburg, Augsburg im Mittelalter, augsburger, Bavaria Bayern, Bayerisch-Schwaben, Аугсбург, JEWISH GERMAN HISTORY - Jüdisch Deutsche Geschichte, jewish men, Medinat Schwaben, Mittelalter, moshe, rest der welt, אַדעלסריעד, אדעלסריעד, אוגסבורג |  Permalink
Permalink
 Posted by yehuda
Posted by yehuda





 Posted by yehuda
Posted by yehuda