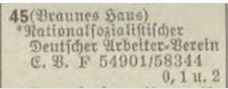am 19. Januar:
1827 Geburt von Emmanuel Lämle, gest. 1893;
1911 Geburt von Jakob Brenerman, gest. 2000;
1928 Tod von Aaron Großberg, geb. 1857;
1887 Tod von Salomon Neuburger, geb. 1818;
2010 Tod von Ernst Cramer in Berlin, geb. 1918 in Augsburg, kehrte im Mai 1945 als US-Soldat bei Kriegsende nach Augsburg zurück, Journalist, Publizist, Vorsitzender der Axel-Springer-Stiftung, ab 2003 Ehrenbürger der Stadt Augsburg;
 Ernst Cramer (1913- 2010)
Ernst Cramer (1913- 2010)
am 20. Januar:
1765 Tod von Isaak Juda Levi, 77 Jahre alt;
1813 Geburt von Mina Pickert, n. Gerstle, gest. 1878;
1862 Geburt von Bertha Neuburger, n. Neumeyer, gest. 1908;
1864 Moses hirschbaum aus Steppach;
1872 Tod von Heinrich Obermayer 1872, Metzgermeister aus Kriegshaber, 80 Jahre alt;
1878 Tod von Nathan Gunz, geb. 1833;
1890 Tod von Max Obermayer;
1903 Tod von Hermann Bach, geb. 1852;
am 21. Januar:
1737 Tod von Ester Ulmo, 54 Jahre alt;
1747 Tod von Sprinz Tannhauser aus Fischach;
1797 Tod von Rosa Ulmo, 25 Jahre alt, gestorben an Fieber;
1800 Tod von David Regensburger;
1817 Tod von Mina Regensteiner, 55 Jahre alt;
1818 Tod von Schimon Hubel, 63 Jahre alt;
1854 Geburt von August Gerstle, gest. 1899;
1862 Geburt von Heinrich Rosenstiel, gest. 1914;
1870 Geburt von Hermann Göggel, gest. 1910;
1871 Geburt von Karl Raff, gest. 1924;
1934 Tod von Rosa Lustig, n. Eigner, geb. 1873;
1941 Tod von Klara Herrmann, n. Gutmann, geb. 1857;
am 22. Januar:
1738 Tod von Jedia Seligman;
1816 Tod von Klara Braumann, Wirtstochter aus Steppach, 27 Jahre alt;
1825 Tod von Kela Schwarz aus Pfersee;
1839 Tod einer Sara … aus Schlipsheim, Alter und Familienname unbekannt;
1840 Tod von Jakob Seligman aus Leimen, 67 Jahre;
1848 Geburt von Michael Heymann, gest. 1919;
1863 Tod von Jona Nördlinger aus Fürth, 2 Jahre alt;
1865 Tod von Gabriel Liebschütz;
1875 Geburt von Samuel Gutmann, gest. 1939;
1891 Geburt von Salo Herrmann aus Oettingen, 1942 in Piaski ermordet;
1925 Tod von Emil Epstein, geb. 1866;
1926 Tod von Albert Kornitzer, geb. 1864;
1926 Tod von Emilie Erlanger, n. Neuburger, geb. 1862;
1935 Tod von Luise Estenfelder, geb. 1880;
am 23. Januar:
1770 Tod von Brendl Ulmo aus Pfersee, 86 Jahre;
1810 Tod von Secharja Neuburger, 84 Jahre;
1835 Tod von Mina Lepert, 44 Jahre;
1840 Geburt Bertha Tannhauser, n. Levinger, gest. 1883
1858 Geburt von Albert Sander; gest. 1939
1870 Tod von Sofie Schnell, fast 3 Jahre alt;
1871 Geburt von Julius Löb, gest. 1908
1885 Tod von Joachim Fromm, geb. 1816
1891 Tod von Hanna Weiss 68 Jahre alt;
1908 Tod von Babette Epstein, n. Rosenfelder, geb. 1837;
am 24. Januar:
1725 Tod von Benjamin Ulmo, geb. 1645;
1796 Tod von Dov Mändle aus Kriegshaber;
1803 Tod von Juda Rapaport aus Fürth;
1880 Geburt von Luise Estenfelder, gest. 1935;
1881 Geburt von Walther Reis, gestorben im Altern von einer Woche;
1888 Tod von Hermann Gutmann, 1914 gefallen im Weltkrieg;




 Posted by yehuda
Posted by yehuda